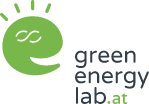Flexibilität im Energiesystem durch Sektorkopplung und Speichertechnologien
Ausgewählte Experten gaben beim Insight Talk von Green Energy Lab am 23. Oktober 2025 spannende Einblicke in innovative Projekte und Lösungen zur Flexibilisierung des Energiesystems durch Sektorkopplung und Speichertechnologien.

© Energie Steiermark
04. November 2025 – Energienetze sehen sich heutzutage zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Mit dem zunehmenden Ausbau von Erneuerbaren Energien verändern sich auch die Anforderungen an sie. Besonders die wetterabhängigen Energiequellen wie Windkraft und Photovoltaik unterliegen Schwankungen in der Erzeugung. Hinzu kommen saisonale Unterschiede, wie beispielsweise stärkere PV-Erträge im Sommer oder ein erhöhter Heizbedarf im Winter. Zwischen Erzeugung und Verbrauch kommt es zudem zu örtlichen und zeitlichen Unterschieden.
Um den genannten Herausforderungen zu begegnen und die Erneuerbaren Energien auszubauen, ist Flexibilität eine zentrale Voraussetzung. Doch wie kann Flexibilität im Energiesystem geschaffen werden? Sektorkopplung und Speicher spielen hierbei eine wichtige Rolle. Beide Themen wurden im Insight Talk von Green Energy Lab am 23. Oktober 2025 näher behandelt. Experten von Energie Steiermark AG, Emerald Horizon AG und SALZSTROM gaben dabei Einblicke in innovative Projekte.
Unter Sektorkopplung versteht man die Vernetzung unterschiedlicher Energiesektoren, wie etwa Strom, Wärme und Verkehr. Dabei spielt die Umwandlung von erneuerbarem Strom in andere Energieformen, wie zum Beispiel Wärme, eine wichtige Rolle. Batterien unterschiedlichster Größe, Wärmespeicher oder Wasserstoff dienen wiederum der Speicherung von Energie, die folglich zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden kann. Grundsätzlich lassen sich folgende Arten der Speichertechnologien unterscheiden:
- Mechanische Energiespeicherung (z.B. Pumpspeicherkraftwerke, Schwungradspeicher)
- Elektrische Energiespeicherung (z.B. Kondensatoren / Superkondensatoren, supraleitende magnetische Energiespeicher)
- Thermische Energiespeicherung (z.B. thermosensible Speicher wie Warmwasserspeicher, latente Speicher und thermochemische Speicher)
- Chemische/Elektrochemische Energiespeicherung (z.B. Batterien, Akkumulatoren, Wasserstoffspeicher, synthetische Kraftstoffe)
Nichts mehr verpassen: Jetzt anmelden zum kostenlosen Newsletter!
Sektorkopplung von Wasserkraft und Wärme in der Steiermark
Mit einer Power-to-Heat-Anlage (P2H-Anlage) präsentierten Jörg Faschallegg und Marco Schabel im Insight Talk ein Beispiel der sektorenübergreifenden Energienutzung. Eine P2H-Anlage wandelt überschüssigen Strom in Wärme um. In Folge kann die Wärme in ein Nah- oder Fernwärmenetz eingespeist werden. Solche Anlagen zeichnen sich durch einfache Technik, einen guten Wirkungsgrad und vergleichsweise geringe Investitionskosten aus. Allerdings setzt ihr Einsatz voraus, dass die Infrastruktur für den Anschluss und die Abnahme der Wärme vorhanden ist.
Die vorgestellte P2H-Anlage ist ein gemeinsames Projekt der Energie Steiermark Green Power GmbH und der Verbund Hydro Power GmbH. Sie befindet sich an der Energieableitung des Wasserkraftwerks Gössendorf zum Umspannwerk Grambach und soll den Strom- und Wärmemarkt miteinander verbinden. Während der im Wasserkraftwerk erzeugte Strom üblicherweise direkt ins Netz fließt, kann etwaiger Überschussstrom auch für den Betrieb der P2H-Anlage genutzt werden. Dort wird er in Wärme umgewandelt und folglich ins Fernwärmenetz eingespeist. Somit kann die gesamte Energie aus dem Wasserkraftwerk unabhängig vom aktuellen Strombedarf genutzt werden.

Power2Heat-Anlage der Energie Steiermark in Gössendorf © Energie Steiermark
Die Powert-to-Heat Anlage in Gössendorf besteht aus einer 10 MW Elektrokesselanlage mit Widerstandheizstäben und Heizregistern. Es wird hervorgehoben, dass es sich um einen Heißwasserkessel mit niedrigem Gefahrenpotenzial handelt und der Betrieb unter 120°C erfolgt. Zwei Wärmetauscher ermöglichen die Einspeisung der Wärme ins Fernwärmenetz. Zusätzlich gibt es einen 5 MWh Heißwasserspeicher als dynamischen Puffer. Das System bietet hohe Effizienz in der Umwandlung von Strom in Wärme und ist außerdem für den Einsatz am Regelenergiemarkt (SRL) qualifiziert.
Modularer Hochtemperatur-Flüssigsalz-Speicher
Dr. Mario J. Müller und Gerhard Greiner von Emerald Horizon AG gingen im Insight Talk genauer auf die Möglichkeiten zur latenten Wärmespeicherung ein und stellten den modularen Hochtemperatur-Flüssigsalz-Speicher CALstore vor. Latente Wärmespeicher verwenden Phasenwechselmaterialien wie Salze oder Paraffine zur Energiespeicherung. Beim Übergang vom festen zum flüssigen Aggregatszustand nehmen diese Materialien Wärmeenergie auf und geben sie bei Bedarf durch den umgekehrten Phasenwechsel, von flüssig zu fest, wieder ab.

Hochtemperatur-Flüssigsalz-Speicher CALstore © Emerald Horizon AG
Der Hochtemperatur-Flüssigsalz-Speicher CALstore ist als 20-Fuß-Container mit einer Speicherkapazität von 5.000 kWh konzipiert. Er soll auf hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand ausgelegt sein. Der Vorteil von Flüssigsalzen als Speichermedium ist, dass sie aufgrund des hohen Schmelzpunkts – je nach Zusammensetzung zwischen 300 und 600 Grad Celsius – eine sehr hohe Energiedichte aufweisen. Gleichzeitig ist der Druck im Inneren des Speichers wesentlich geringer als beispielsweise bei Heißwasserspeichern.
Zum Laden von CALstore soll Abwärme aus Industrieprozessen oder überschüssige Energie aus wetterabhängigen, erneuerbaren Energiequellen verwendet werden. Die Wärme kann anschließend kontinuierlich über Wärmetauscher entnommen werden. Ebenso kann der Speicher, falls erforderlich, auch als direkte Hochtemperaturquelle für Industrieprozesse dienen oder die Energie mittels Heat2Power verstromt werden.
Das Projekt CALstore wurde von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG gefördert und mit dem Energy Globe Award Styria 2025 ausgezeichnet. Mehr Informationen finden Sie in der Präsentation über CALstore.
Salzbatterien als nachhaltiger Stromspeicher
Peter Arnold von SALZSTROM widmete sich schließlich den elektrochemischen Speichern und stellte die Frage „Goodbye Lithium?“. Heutzutage werden Lithium-Ionen-Batterien unter anderem aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses am häufigsten eingesetzt, beispielsweise in PV-Batteriespeichern oder E-Fahrzeugen. Allerdings ist Lithium begrenzt verfügbar und auch ungleichmäßig auf der Welt verteilt, was mit Abhängigkeiten von anderen Ländern bei Rohstoffen einhergeht. Außerdem sind Abbau und Entsorgung von Lithium mit erheblichen Eingriffen in die Umwelt verbunden. Anstatt Lithium-Batterien können auch Natrium-Ionen-Batterien eingesetzt werden, welche umgangssprachlich auch als Salzbatterien bezeichnet werden. Natrium gehört zu den meist verfügbaren Rohstoffen auf der Erde und stellt somit im Bereich der Energiespeicherung eine nachhaltigere Alternative zu Lithium dar.
Zu den salzbasierten Batterien gehören beispielsweise Thermalbatterien, welche geschmolzenes Salz als Elektrolyt verwenden, sowie wässrige oder organische Elektrolyte. SALZSTROM ist auf Natrium-Ionen-Batterien mit organischen Elektrolyten spezialisiert. Diese Batterien bestehen aus einer Kathode, einer Anode, einem Separator und einem Elektrolyten. Natrium-Ionen-Batterien sind somit ähnlich aufgebaut wie Lithium-Ionen-Batterien und sie haben auch die gleichen Formen. Dadurch kann auf die gleiche Infrastruktur wie bei Lithium-Ionen-Akkus zurückgegriffen werden und die Akkus lassen sich in denselben Geräten und Anlagen nutzen. Dabei haben Salzbatterien zwar eine geringere Energiedichte als Lithium-Batterien, zeichnen sich dafür aber durch eine höhere Sicherheit aus, etwa durch geringere Brandgefährlichkeit.

Speicher von SALZSTROM gibt es in unterschiedlichen Kapazitäten, als Heimspeicher mit 4,5 kWh (links) bis hin zum Gewerbespeicher mit 115 kWh (Mitte) oder als Großspeicher im Containerformat mit 2,3 MWh © SALZSTROM

Natrium-Ionen-Batterien in unterschiedlichen Ausführungen als Heim- und Gewerbespeicher © SALZSTROM
SALZSTROM kooperiert derzeit mit der Burgenland Energie AG, um gemeinsam Salzstromspeicher auf den Markt zu bringen. Die Batteriespeicher können bei bestehenden sowie neuen Anlagen eingesetzt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Website der Burgenland Energie AG.
Kontakt
Ludwig Fliesser
Communications Manager
T: +43 676 471 93 47
E: ludwig.fliesser@greenenergylab.at