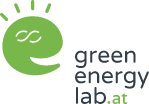Nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung als wichtiger Baustein der Energiewende
Im Insight Talk von Green Energy Lab gemeinsam mit AEE INTEC stellten namhafte Expert:innen am 30. Jänner 2025 Möglichkeiten einer klimaneutralen Wärme- und Kälteversorgung für Gebäude und Quartiere vor.

19. Februar 2025 – Der Wärmesektor ist in Österreich für etwa die Hälfte des Endenergieverbrauchs verantwortlich und der Großteil dieser Energie stammt immer noch aus fossilen Quellen. Für eine erfolgreiche Energiewende braucht es deshalb vor allem auch eine Wärmewende.
Ein besonders großer Hebel zur Transformation des Wärmesektors hin zu nachhaltigen Energiequellen ist die Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden und Quartieren. Green Energy Lab und AEE INTEC widmeten sich in Kooperation diesem Schwerpunktthema und veranstalteten einen Insight Talk zur Nachhaltigen Wärme- und Kälteversorgung der Zukunft. Vorgestellt wurden innovative Technologien zur Nutzung von grüner Wärme und Kälte in Gebäuden und Quartieren. Renommierte Expert:innen präsentierten dabei Lösungen, die einen konkreten Beitrag für eine nachhaltige Wärmeraumplanung sowie Nah- und Fernwärme leisten können.
Einblicke in die Wärmeraumplanung – Perspektiven und Entwicklungen
Alexander Rehbogen vom Salzburger Institut für Raumplanung (SIR) gab wertvolle Einblicke in die Wärmeraumplanung und betonte die Bedeutung solider räumlicher Informationen für die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Gemeinsam mit Partnern aus ganz Österreich wird intensiv daran gearbeitet, die Wärmeraumplanung voranzutreiben. Während Wärmeversorgung, Strom und Mobilität wichtige Faktoren der räumlichen Energieplanung sind, liegt der Fokus insbesondere auf der Wärmeraumplanung, da diese aus hoheitlicher Sicht die größte Relevanz hat.
Rahmenbedingungen auf EU-Ebene
Die Europäische Union setzt mit ihren Richtlinien wichtige Impulse für die Wärmeraumplanung:
- EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED III) – Artikel 25
→ Bewertung und Planung der Wärme- und Kälteversorgung
→ Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass Gemeinden mit mehr als 45.000 Einwohner:innen lokale Pläne für Wärme- und Kälteversorgung erstellen. - EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED III) – Artikel 26
→ Definition effizienter Fernwärme- und -kältesysteme
→ Verpflichtung zur schrittweisen Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger
Vorbilder: Dänemark und Deutschland
Österreich orientiert sich an den Erfahrungen von Dänemark und Deutschland, um die Wärmeraumplanung effizient weiterzuentwickeln und innovative Lösungen für Neubau- und Sanierungsgebiete zu schaffen. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, bestehende Förderungen und Regularien anzupassen, um beispielsweise den Ausbau von Niedertemperaturnetzen zu ermöglichen.
In Dänemark wird das Ziel verfolgt, bis 2050 rund 80 Prozent des Wärmebedarfs über Fernwärme zu decken. Dabei wird der Anteil an Biomasse, dessen Potenzial weitgehend ausgeschöpft ist, schrittweise reduziert. Stattdessen rücken Wärmepumpen als primäre Wärmequelle in den Fokus. Diese Entwicklung erfordert eine kontinuierliche Anpassung der Infrastruktur und gezielte Fördermaßnahmen.
Deutschland geht mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) einen klaren Schritt in Richtung klimafreundlicher Wärmeversorgung. Ab 2024 bzw. 2026 dürfen im Neubau nur noch Heizungen installiert werden, die mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie nutzen. Ergänzend dazu wird mit dem Wärmeplanungsgesetz die kommunale Wärmeplanung verpflichtend: Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohner:innen müssen Wärmepläne erstellen. Darüber hinaus bietet Deutschland mit seinem Kompetenzzentrum zur kommunalen Wärmewende eine zentrale Anlaufstelle für Fachwissen, Grundlagenarbeit und die strategische Kommunikation der Wärmewende.
Wärmeplanung in Österreich
Auch in Österreich gewinnt die strategische Wärmeplanung zunehmend an Bedeutung. Die Stadt Wien setzt mit ihrem Wärmeplan 2040 auf eine detaillierte Zonierung bebauter Gebiete, um Alternativen zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas gezielt aufzuzeigen. Diese Maßnahmen sollen eine nachhaltige und effiziente Wärmeversorgung sicherstellen.
Ein Vorzeigebeispiel in Österreich ist die Steiermark, die bereits entscheidende Regularien in ihrem Raumordnungsgesetz verankert hat. Dadurch wird eine strukturierte und langfristige Planung ermöglicht, die den Umstieg auf erneuerbare Energien erleichtert.
Zusätzlich unterstützt der Energie-Atlas die Wärmeraumplanung, indem er räumliche Energiedaten in einem Bottom-up-Ansatz zusammenführt. So können etwa Daten zu Ölkesseln (Anzahl, Alter, Leistung) erfasst und auf dieser Grundlage gezielte Maßnahmen abgeleitet werden. Bürger:innen, Gemeinden und Landesregierungen erhalten dadurch wertvolle Einblicke und können ihre individuellen Bedarfe selbstständig ermitteln.
Ein weiteres innovatives Tool ist der Energie-Kompass Salzburg, der auf Knopfdruck Informationen zu innovativen Wärmenetzen bereitstellt. Nutzer:innen können durch die Eingabe einer Adresse mögliche Anschlussoptionen sowie Kontakte zu Installateuren abrufen. Diese digitalen Werkzeuge tragen maßgeblich dazu bei, die Wärmeraumplanung in Österreich praxisnah und effizient umzusetzen.
> Insight Talk: Nah- und Fernwärmelösungen >> hier geht´s zum Nachbericht zum Insight Talk „Nah- und Fernwärmelösungen in der regionalen Wärmeraumplanung“!
Innovative Anergienetz-Technologien – Einblicke und Praxisbeispiele
Lorenz Leppin (AEE INTEC) präsentierte zukunftsweisende Anergienetz-Technologien und zeigte praxisorientierte Beispiele, wie Niedertemperaturnetze zur Energieeinsparung und nachhaltigen Wärmeversorgung beitragen. Anergienetze, die ungerichtet arbeiten und sowohl Energie entnehmen als auch einspeisen können, bieten zahlreiche Vorteile wie geringe Transportverluste, effiziente Einbindung regenerativer Energiequellen (z. B. Abwärme, Solarthermie, PVT-Module) und eine Nutzung als Kühlung im Sommer.
Praxisbeispiele:
- FGZ Zürich – Projekt DeStoSimKaFe: In diesem Projekt wird ein Anergienetz mit über 5.000 Verbraucher:innen betrieben. Abwärme von Rechenzentren und dezentrale Wärmepumpen sorgen für eine effiziente Wärmeverteilung. Saisonale Speicherung erfolgt durch ein geothermisches Sondenfeld.
- Amstetten – Projekt AMSL 2023: Hier wird die Revitalisierung des Stadtkerns durch den Neubau von Büro- und Wohnkomplexen vorangetrieben. Verschiedene thermische Versorgungskonzepte, darunter Anergienetze, führten zu niedrigeren Wärmeverlusten und zusätzlichen Energiegewinnen durch Erdwärme.
- Herzogenburg – Garten der Generationen (Projekt Anergy2Plus): Ein integratives Wohnquartier setzt auf dezentrale Wärmepumpen, Kurzzeitspeicher, Bohrlöcher und Fundamentspeicher sowie solarthermische Kollektoren für eine nachhaltige Wärmeversorgung.
Diese Praxisbeispiele zeigen das Potenzial von Anergienetzen, eine nachhaltige und effiziente Energieverteilung zu ermöglichen und verschiedene Energiequellen sinnvoll zu integrieren.
Quartierslösungen in Wien – Best-Practice-Beispiel Meischlgasse
Roman Geyer von der Wien Energie präsentierte das Wiener Stadtquartier Meischlgasse als herausragendes Best-Practice-Beispiel für moderne und nachhaltige Wärmeversorgung. Das Quartier verkörpert eine zukunftsorientierte Lösung, die zahlreiche innovative Ansätze zur Wärmewende integriert und als Vorzeigeprojekt für die klimaneutrale Stadtentwicklung Wiens dient. Wien verfolgt das ambitionierte Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, wobei Wärmeverbundlösungen eine zentrale Rolle spielen.
Kernaspekte der Wärmeverbundlösungen
Wärmeverbundsysteme bieten eine hohe Effizienz, indem sie Synergien zwischen Abwärmenutzung und Wärmebedarf schaffen. Mögliche Lösungen umfassen:
- Fernwärmenetze
- Quellnetze
- Kalte Nahwärmenetze (Anergie)
- Kombinationen dieser Systeme für eine maßgeschneiderte, bedarfsgerechte Energieversorgung
Durch die unterschiedliche Ausgestaltung dieser Systeme (Temperaturniveau, Speisung, Druck, Materialien und Leitungsdimensionen) können verschiedene Anforderungen und Gegebenheiten optimal berücksichtigt werden. Insbesondere im Neubau ist die Integration neuer Technologien einfach umzusetzen, während im Bestand die Anpassung bestehender Infrastrukturen erforderlich ist.
Berücksichtigung von Standortressourcen
Für eine nachhaltige Quartiersplanung sind diverse lokale Ressourcen von entscheidender Bedeutung:
- Fernwärme
- Abwärme
- Erdwärme
- Thermische Grundwassernutzung
- Sonnenenergie
- Luftwärme
Diese vielfältigen Ressourcen werden gezielt kombiniert, um einen effizienten und umweltfreundlichen Energiemix zu gewährleisten.
Entwicklungsprozess – Wichtige Überlegungen und Planung
Vor der Realisierung eines Quartiers müssen grundlegende Fragen zur Energieversorgung und zum spezifischen Bedarf der zukünftigen Nutzer:innen geklärt werden. Dabei sind folgende Aspekte entscheidend:
- Welche Energiequellen sollen genutzt werden?
- Welche Art von Nutzung ist vorgesehen (z. B. Wohnquartier)?
- Wie hoch ist der spezifische Bedarf (z. B. für Heizung, Warmwasser, Kühlung)?
Zur Planung und Optimierung der Energieversorgung nutzt Wien Energie fortschrittliche Simulationsprogramme. Diese ermöglichen eine präzise Modellierung der Energieflüsse bereits vor Baubeginn, was eine effiziente Integration des gesamten Energiemixes ermöglicht und so eine nachhaltige und zukunftssichere Versorgung garantiert.
Fazit: Das Quartiersprojekt Meischlgasse stellt eindrucksvoll unter Beweis, wie durch gezielte Planung, die Integration innovativer Technologien und die Berücksichtigung lokaler Ressourcen eine effiziente, nachhaltige und klimafreundliche Wärmeversorgung erreicht werden kann. Dieses Modell liefert wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung weiterer klimaneutraler Quartiere und trägt zur Verwirklichung von Wiens Ziel bei, bis 2040 klimaneutral zu werden.
Hintergrundinformationen
Der Gebäudesektor ist in Österreich für rund 50 % des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich. Eine nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung ist daher ein zentraler Hebel zur Erreichung der Klimaziele. Neue Technologien sowie optimierte Datengrundlagen in der Wärmeraumplanung können dazu beitragen, diesen Energieverbrauch erheblich zu senken. Insbesondere Anergienetze, auch als Niedertemperaturnetze bekannt, spielen hierbei eine entscheidende Rolle.
Wärmeraumplanung ist ein strategisches Planungsinstrument zur effizienten und nachhaltigen Wärmeversorgung in Städten und Regionen. Durch die Analyse von Energiebedarf, vorhandenen Ressourcen und infrastrukturellen Gegebenheiten können maßgeschneiderte Lösungen für eine klimafreundliche Wärmeversorgung entwickelt werden. Besonders wichtig sind dabei verlässliche Daten und digitale Tools zur Optimierung von Planungsprozessen.
(Allgemeine Netze umfassen Fernwärme- und Nahwärmenetze, die Gebäude oder Quartiere mit zentral erzeugter Wärme versorgen. Diese Netze nutzen verschiedene Energiequellen wie Biomasse, Geothermie oder Abwärme, um eine stabile und nachhaltige Versorgung zu gewährleisten.)
Anergienetze sind spezielle Niedertemperaturnetze, die auf die Nutzung von Abwärme, Umweltwärme und erneuerbaren Quellen setzen. Sie transportieren Wärme auf einem niedrigen Temperaturniveau (z. B. 10–30°C) und ermöglichen durch dezentrale Wärmepumpen eine flexible Nutzung für Heizen und Kühlen. Anergienetze sind besonders effizient und ermöglichen eine hohe Integration erneuerbarer Energien. Diese Konzepte könnten maßgeblich zur Reduktion von CO₂-Emissionen und zur nachhaltigen Transformation des Energiesektors beitragen.
Alle Präsentationen zum Downlaod und als Video zum nachsehen
- Alexander Rehbogen – SIR Salzburger Institut für Raumplanung_30.01.2025
- Lorenz Leppin – AEE INTEC – Anergienetze 30.01.2025
- Roman Geyer – WIEN ENERGIE – Quartier Meischlgasse 30.01.2025
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Kontakt
Ludwig Fliesser
Communications Manager
T: +43 676 471 93 47
E: ludwig.fliesser@greenenergylab.at