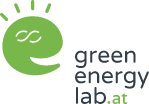Green Energy Lab und AEE INTEC bündeln Kompetenzen für die Wärmewende
Die Forschungsinitiative Green Energy Lab und AEE – Institut für Nachhaltige Technologien treiben gemeinsam die Entwicklung von Lösungen für die Wärmewende voran.

Andrea Edelmann, Obfrau und Vorstandssprecherin von Green Energy Lab (links), Christian Fink, Geschäftsführer von AEE INTEC (rechts) © Green Energy Lab / Stephanie Weinhappel
Wien, 15.05.2025 – Green Energy Lab und AEE – Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC) sind seit langem durch ihr gemeinsames Bestreben verbunden, die Energiewende durch Forschung und Entwicklung technologischer Lösungen und innovativer Geschäftsmodelle voranzubringen. Ein besonderer Fokus der gemeinsamen Aktivitäten liegt auf der Transformation des Wärme- und Kältesektors.
In Österreich ist die Bereitstellung von Wärme für rund die Hälfte des Endenergieverbrauchs verantwortlich. Gleichzeitig wird dieser Energiebedarf überwiegend durch fossile Quellen wie Heizöl oder Erdgas gedeckt. Will man die Energiewende schaffen, um CO₂-Emissionen einzusparen und die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren, dann hat die Dekarbonisierung der Wärme- und Kälteversorgung hohe Priorität. Um diesen Prozess zu unterstützen und zu beschleunigen, arbeitet das Green Energy Lab intensiv mit AEE INTEC im Rahmen des Programms „Vorzeigeregion Energie“ des Klima- und Energiefonds zusammen. In Zukunft wollen diese Key-Player der Energieinnovation noch enger für eine nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung in Österreich kooperieren.
Geballte Kompetenz für Forschung und Entwicklung
Green Energy Lab und AEE INTEC verfügen über reichlich Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung nachhaltiger Energielösungen. Das Green Energy Lab wurde von den Energieunternehmen Wien Energie, EVN, Burgenland Energie und Energie Steiermark gegründet. Es handelt sich um eine beispiellose Kooperation marktorientierter Unternehmen und der öffentlichen Hand im Bereich der angewandten Energieforschung. Dazu betreibt Green Energy Lab das größte Innovationslabor für nachhaltige Energielösungen in Österreich und koordiniert über 50 kooperative Forschungs- und Innovationsprojekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 150 Millionen Euro.
„Die angewandte Forschung legt den Grundstein für eine erfolgreiche Transformation des Energiesystems, um Emissionen einzusparen und die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, insbesondere in der Wärmeversorgung, zu verringern. Innovationen für nachhaltiges Heizen und Kühlen leisten einen wichtigen Beitrag zur Resilienz unseres Energiesystems und für die Versorgungssicherheit. Der Austausch und Wissenstransfer zwischen Forschenden, Praktikern und Akteuren aus dem Energiesektor ist dabei essenziell, damit entwickelte Lösungen rasch umgesetzt und skaliert werden können“, sagt Andrea Edelmann, Obfrau und Vorstandssprecherin von Green Energy Lab.
Andrea Edelmann, Obfrau und Vorstandssprecherin von Green Energy Lab
© Green Energy Lab / Stephanie Weinhappel
Zahlreiche Projekte im Green Energy Lab werden von AEE INTEC geleitet. Die Expertise dieser außeruniversitären Forschungseinrichtung mit rund 90 Mitarbeiter:innen liegt in der Entwicklung neuer Technologien sowie deren Systemintegration – unter anderem für den gesamten Wärme- und Kältesektor. Das Forschungsspektrum reicht dabei von Entwicklungen im Gebäudesektor über die produzierende Industrie bis zur Versorgung von Gebäudeclustern, Quartieren, Städten und Regionen. Auf der technologischen Ebene werden Entwicklungen und Optimierungen betrieben im Bereich der Energieeffizienzsteigerung (hocheffiziente thermische Sanierungen, Abwärmenutzung, Prozessintensivierung etc.). Im Bereich der Konversionstechnologien liegt der Entwicklungsschwerpunkt auf Solarenergie, Wärmepumpen, der Umwandlung von Strom in Wasserstoff (inkl. Rückverstromung) sowie der stofflichen und chemischen Speicherung von elektrischer Energie (P2H2P bzw. P2X).
Zentrales Augenmerk der Forschungsarbeiten liegt auch auf der leitungsgebundenen Wärme- und Kälteversorgung (Nah- und Fernwärmenetze, Niedertemperatur- und Anergienetze) sowie auf der Entwicklung von Technologien für Energieflexibilität (Speicherung von Wärme und Kälte, Demand Side Management, intelligente Regelungen). Die Entwicklung neuer Methoden und Ansätze für kommunale Energieraumplanung, Kreislaufwirtschaft, urbane Symbiosen sowie im Bereich der Klimawandelanpassung runden das Arbeitsspektrum ab.

Christian Fink, Geschäftsführer von AEE INTEC
© Green Energy Lab / Stephanie Weinhappel
„Der jährliche Wertschöpfungsabfluss in andere Wirtschaftsregionen durch die Nutzung fossiler Energieträger liegt für Österreich seit vielen Dekaden im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Nur durch die konsequente und zielgerichtete Generierung von Innovation im Energiesektor kann diese Situation verbessert bzw. gänzlich umgekehrt werden. Der Wärme- und Kältesektor bietet hier einen immensen Hebel und besitzt gleichzeitig großes Potenzial für die Erlangung regionaler Energie- und Technologiesouveränität und damit eine einhergehende Attraktivierung unseres Wirtschaftsstandortes“, sagt Christian Fink, Geschäftsführer von AEE INTEC.
Lösungen für eine nachhaltige Wärmezukunft
Green Energy Lab und AEE INTEC arbeiten bereits seit vielen Jahren bei der Entwicklung von Lösungen für eine nachhaltige Wärmezukunft zusammen, etwa im preisgekrönten Großforschungsprojekt „ThermaFLEX“. Die dort angewandten Methoden zur Effizienzsteigerung und Integration von erneuerbaren Energien in Fernwärmesysteme sind in Österreich und darüber hinaus wegweisend. So wurde die Restwärme im Abwasser aus dem Kanal und von einer Kläranlage nutzbar gemacht, die Einbindung von Solarthermie-Anlagen in netzgebundene Wärmeversorgungssysteme erprobt oder auch die Wärmeenergie aus dem Rauchgas einer Müllverbrennungsanlage für die Fernwärmeversorgung verwendet. Für diese Musterlösungen zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung wurde das Projekt mit dem „Energy Globe Award Austria“ ausgezeichnet.

In Mürzzuschlag in der Steiermark wurde die Einbindung einer großflächigen
Solarthermie-Anlage in ein netzgebundenes Wärmeversorgungssystem umgesetzt und erprobt.
© SOLID / Podesser
Inzwischen ist fast jeder vierte Haushalt in Österreich an ein Wärmenetz angeschlossen. In der Bundeshauptstadt betreibt die Wien Energie eines der größten Fernwärmesysteme Europas. Die Stadt will bis 2040 klimaneutral werden, Raumwärme und Warmwasser in Gebäuden sollen dann ausschließlich erneuerbar bereitgestellt werden. Damit das gelingen kann, müssen im Sommer produzierte Wärmeüberschüsse in den Winter mitgenommen werden. Dazu braucht es entsprechend große Speicher. Im Projekt „ScaleUp“ wird an der Realisierung eines unterirdischen Großwärmespeichers gearbeitet, um erstmalig eine Pilotanlage im städtischen Raum zu errichten. Diese funktioniert wie eine gewaltige Thermoskanne, die sich unter der Erdoberfläche befindet und große Mengen Heißwasser speichern kann. Eine weitere Option der saisonalen Wärmespeicherung gibt es auch in unterirdischen Hohlräumen, sogenannten Aquiferen oder Thermalwasserlinsen. Deren Nutzung wird seitens der Wien Energie im Rahmen von Green Energy Lab ebenfalls erforscht und entwickelt.
Eine Hochtemperatur-Großwärmepumpe in der Müllverbrennungsanlage Wien Spittelau sorgt
für die nachhaltige Fernwärmeversorgung von 16.000 Haushalten zusätzlich.
© Wien Energie / Johannes Zinner
Die Speicherung von Energie ist auch für die EVN in Niederösterreich ein zentrales Thema. In Theiß steht einer der größten Wärmespeicher Europas mit einem Fassungsvermögen von rund 50.000 Kubikmetern. Dabei handelt es sich um einen zylindrischen Turm mit 50 Metern Durchmesser, der bis zu 25 Meter hoch mit Heißwasser befüllt ist. Er dient als Speicher für das Fernwärmenetz Krems. Kürzlich wurde die Anlage in Theiß zu einem innovativen Hybridspeichersystem ausgebaut. Dazu ergänzte die EVN den thermischen Speicher um ein elektrisches Batteriespeichersystem mit einer Kapazität von sechs Megawattstunden. Das entspricht dem täglichen Stromverbrauch von mehr als 600 Haushalten. Dieser Batteriespeicher wurde mit einer neu errichteten Photovoltaik-Großanlage und einem Elektroheizsystem kombiniert. Je nach Wetterlage und Bedarf kann jetzt elektrische Energie für das Stromnetz erzeugt und gespeichert, oder – im Falle von Stromüberschüssen – in Wärme umgewandelt werden. Innovative Methoden der künstlichen Intelligenz ermöglichen einen optimalen Betrieb. Im Rahmen von Green Energy Lab entwickelt und erprobt die TU Wien mit EVN und dem Austrian Institute of Technology (AIT) dazu auch erweiterte Prognosekonzepte für die Photovoltaik-Energieerzeugung sowie intelligente Monitoringkonzepte für das Speichersystem.

In Theiß in Niederösterreich steht einer der größten Wärmespeicher Europas. Der thermische
Speicher wurde um ein elektrisches Batteriespeichersystem mit einer Kapazität von 6 MWh
zu einem innovativen Hybridspeichersystem ergänzt. © Green Energy Lab
Mit saisonaler Energiespeicherung befasst sich auch die Energie Steiermark gemeinsam mit AEE INTEC im Projekt „FlexModul“. Ziel ist die Entwicklung und Demonstration eines innovativen, modularen und kompakten Sorptionsspeichersystems, eines sogenannten thermochemischen Speichers. Diese Technologie zeichnet sich durch hohe Energiespeicherdichte und Flexibilität, geringe Verluste und einfache Handhabung für Gebäudeanwendungen aus. Aufgrund des modularen Aufbaus ist ein Sorptionsspeichersystem leicht skalierbar und an verschiedene Anwendungen im Wärme- und Stromsektor anpassbar. Eine langfristige Speicherung von Energie ist nahezu verlustfrei möglich. Ein Anwendungsfall ist die saisonale Speicherung von Solarenergie für ein Einfamilienhaus. Überschüssige Energie aus der hauseigenen Photovoltaikanlage kann damit vom Sommer in den Winter gespeichert werden und ermöglicht so eine nahezu hundertprozentige Versorgung mit Solarenergie. Über ein Power-to-Heat-Speicherkonzept kann elektrische Energie dazu auch in Wärme umgewandelt werden.
Der Ausgleich von Lastspitzen im Stromnetz ist für die Burgenland Energie ein Kernthema. Die Pannonische Tiefebene ist gekennzeichnet von zahlreichen Windkraftanlagen. Während dieser Windstrom inzwischen einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Energieproduktion in Österreich leistet, ist dessen Verfügbarkeit nicht steuerbar. Es gibt Zeiten, in denen der erzeugte Strom nicht genutzt werden kann und die Windräder daher abgeschaltet werden müssten. Wertvolle und völlig emissionsfreie Energieproduktion bleibt damit ungenutzt. Genau hier setzt das Projekt „Hybride Fernwärme Neusiedl“ an. Um Windstrom auch dann nutzen zu können, wenn er im Stromnetz nicht gebraucht wird, hat die Burgenland Energie den nahe gelegenen Windpark an das Fernwärmenetz von Neusiedl am See angeschlossen. Dort kann mittels gewaltiger Wärmepumpen der Strom in Wärme umgewandelt werden – ein Musterbeispiel für intelligente Sektorkopplung, die für eine erfolgreiche Energie- und Wärmewende unverzichtbar sein wird.

Sektorkopplung: In Neusiedl am See kann dank innovativer Wärmepumpentechnologie
nachhaltiger Windstrom für die Fernwärmeproduktion genutzt werden, wenn er nicht
anderweitig im Netz gebraucht wird. © Burgenland Energie
Breite Allianz für Innovation
Der sogenannte Innovator Circle von Green Energy Lab besteht aus über 350 Unternehmen und Institutionen aus marktnaher Forschung, Wirtschaft und der öffentlichen Hand. Darunter befinden sich bekannte Technologieunternehmen wie Infineon, Siemens, Jenbacher, Herz oder Rabmer Technologies, die großen Baukonzerne Strabag und Porr, Energieunternehmen sowie renommierte Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.
Viele Mitglieder des Innovator Circles beteiligen sich aktiv als Projektpartner am offenen Innovationsprozess im Green Energy Lab. So forscht etwa das Austrian Institute of Technology im Rahmen des Projekts „DeRiskDH“ daran, die mit der Einbindung von alternativen Wärmequellen in Fernwärmenetze einhergehenden Herausforderungen zu lösen. Ziel ist es, die damit verbundenen hohen Investitionskosten und Unsicherheiten hinsichtlich der Energiepreise, der Verfügbarkeit alternativer Wärmequellen und saisonaler Speicher sowie der Durchführung von Nachrüstungs- und Optimierungsmaßnahmen zu minimieren.
Pioniere im Bereich der Digitalisierung kommunaler Wärmenetze sind auch Güssing Energy Technologies und Ateria, die im Projekt „DOPPLER“ digitale Abbilder von Fernwärmenetzen zu Simulationszwecken erstellen. Diese „Digitalen Zwillinge“ der Wärmenetze können vielseitig genutzt werden. Sie dienen als Basis zur Optimierung des Betriebs und zur Verringerung von Energieverlusten im Netz. Außerdem helfen sie bei der Planung und Weiterentwicklung von Fernwärmesystemen: Der Anschluss neuer Erzeugungsanlagen und zusätzlicher Wärmekunden kann simuliert werden. Das vereinfacht auch die Integration alternativer Wärmequellen – etwa die Nutzung von Abwärme aus Industrieanlagen. Mithilfe computergestützter Simulationen kann das Netz gezielt darauf vorbereitet und ausgebaut werden.
Wenn es um Planung geht, dann ist auch das Salzburger Institut für Raumplanung (SIR) federführend. Im Rahmen des Projekts „Spatial Energy Planning“ wurden Energiedaten mit hochauflösenden Karten im Geoinformationssystem verknüpft, sodass auf Knopfdruck relevante Informationen zur Energieversorgung auf Grundstücksebene abgerufen werden können. Was zunächst in Salzburg, der Steiermark und Wien entwickelt wurde, wird nun österreichweit ausgerollt und dient als Paradebeispiel für die Energie- und Wärmeraumplanung in ganz Europa und darüber hinaus.
Über Green Energy Lab
Die Forschungsinitiative Green Energy Lab ist ein gemeinnütziger Verein für angewandte Forschung und Innovation im Bereich erneuerbare Energie- und Wärmelösungen. Gründungsmitglieder sind die Energieversorgungsunternehmen Energie Steiermark, EVN, Wien Energie und Burgenland Energie. Der Fokus der Vereinsaktivität liegt auf der Entwicklung, Umsetzung und Systemintegration von Energieinnovationen an der Schnittstelle zwischen Technologieentwicklung und dem Markt. Seit 2018 betreibt das Green Energy Lab im Rahmen des Förderprogramms „Vorzeigeregion Energie“ des Klima- und Energiefonds Österreichs größtes Innovationslabor für eine nachhaltige Energiezukunft.
Über AEE INTEC
AEE – Institut für Nachhaltige Technologien (AEE INTEC) wurde 1988 gegründet und ist heute mit über 90 Mitarbeiter:innen eines der führenden europäischen Institute der angewandten Forschung auf dem Gebiet erneuerbarer Energie und Ressourceneffizienz. In den drei Zielgruppenbereichen „Gebäude“, „Städte & Netze“ und „Industrielle Systeme“ sowie drei technologischen Arbeitsgruppen „Erneuerbare Energien“, „Thermische Speicher“ sowie „Wasser- und Prozesstechnologien“ reicht die Palette der durchgeführten F&E-Projekte von grundlagennahen Forschungsprojekten bis hin zur Umsetzung von Demonstrationsanlagen. Seit 2015 ist AEE INTEC Mitglied von Austrian Cooperative Research (ACR).
Kontakt
Ludwig Fliesser
Communications Manager
T: +43 676 471 93 47
E: ludwig.fliesser@greenenergylab.at